Gewaltig Viele Fragen
News |

Mozart! So oft denke ich über Sie nach. Über Ihre Werke, über Interpretationen und wie man sich Ihnen nähern kann, darf und soll. Weniger in inneren Gesprächen mit Ihnen, wie ich es heute mache, sondern meistens geht es um die Sache an sich, um Ihre Musik.
Ein solches Gespräch beginnt ja schon mit der Frage: Wie soll ich Sie ansprechen? Darf ich »Du« sagen? Vielleicht lieber nicht. Ich fühle mich zwar Ihrer Musik eng verbunden, aber dennoch: Sie bleiben auf einem Podest, in Gedanken sind Sie also für mich nicht Wolfgang, sondern Mozart.
Und doch: Darf ich einen Augenblick lang sehr persönlich werden? Wollen Sie wissen, wie ich Sie mir vorstelle? Es gab und gibt ja so viele Mozart-Bilder über die Jahrhunderte – teilweise wird einem ein artiges Rokoko-Wolferl gezeigt, teilweise sieht man ein exaltiertes Genie. Rund 200 Jahre nach Ihrem Tod hat ein englischer Dramatiker namens Peter Shaffer ein Schauspiel über Sie und Salieri verfasst, das sehr erfolgreich verfilmt wurde. – »Verfilmt wurde«: Ich erkläre Ihnen später, was das bedeutet –, jedenfalls war das ein fast karikaturhafter, wilder Mozart, ein Kind des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Wie aber waren Sie wirklich? Für mich müssen Sie ein ungemein ungeduldiger Mensch gewesen sein. Wie sollte es denn auch anders sein? Wenn man bedenkt, wie unglaublich viele Werke Sie in so kurzer Lebenszeit verfasst haben, dazu die zahlreichen Reisen quer durch Europa – um das alles in ein Leben zu packen, da muss man hyperaktiv sein, extrem geschäftig, ungeduldig. Und es stand schon auch, wenn man Ihren Briefen glauben darf, ein Sinn für Kariere dahinter. Im Gegensatz zu anderen, wie Joseph Haydn, der sehr lange am Esterhazy’schen Hof weilte, waren Sie weniger sesshaft und blieben bei keinem sehr lange. Immer trieb es Sie weiter; da war durchaus auch Ehrgeiz dahinter, oder?
Darf ich noch etwas erzählen? Über meinen ersten Kontakt mit Ihnen … Ich war etwa neun Jahre alt und hörte Don Giovanni – eine Schallplattenaufnahme mit Josef Krips. Ich kannte noch sehr wenig aus dem Opernrepertoire und war überwältigt von der Originalität der Partitur. Und ich entdeckte in der längeren Beschäftigung mit Ihren Kompositionen bald das Geheimnis von Meisterwerken. Je tiefer man, getrieben vom Forschergeist, in ein Werk eindringt, umso mehr will man wissen. Man entdeckt Parallelen zu anderen Stücken, zu anderen Komponisten – Besonderheiten. Und das hält bis heute an, dieses Forschen-Wollen und Immer-Neues-finden-Dürfen.
Wissen Sie, was ich mir oft ausmale? Die historische Aufführungssituation. Ich versuche mir vorzustellen, einer der Künstler zu sein, die bei den ersten Aufführungen dabei waren. Denn zweifelsohne wäre es unglaublich bereichernd, ein Werk in seinem historischen Kontext zu erleben – in einem der nicht mehr existenten Theater, im alten Burgtheater am heutigen Michaelerplatz in Wien zum Beispiel. Ich male mir aus, in einem dieser Räume zu sein, und frage mich: Wie hat es wohl geklungen? Wie war die Akustik?
Natürlich, das wird man nie wissen, aber allein die Beschäftigung mit diesen Fragen bringt uns weiter und gehört selbstverständlich zu den Vorbereitungen einer heutigen Aufführung. Denn worum geht es? Dem Komponisten schon dadurch Respekt zu erweisen, dass wir versuchen, so nahe wie möglich an seine Gedankenwelt zu gelangen – selbst wenn unser Wissen um die historische Aufführungskultur lückenhaft ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Ihrer Opern dirigieren müsste, während Sie mir zuhören – das wäre ungemein spannend. Ich wäre nervös, sehr nervös. Denn Komponisten sind eben die Schöpfer des Werks, und wir Interpretinnen und Interpreten doch nur jene, die es ausführen. Selbstverständlich bringen wir unsere Kreativität und Kunstfertigkeit ein, aber dennoch: Erschaffen haben Sie und Ihre Kollegen die großen Werke. Daher stehen Komponisten für mich in gewisser Weise etwas erhöht. Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich von einem Ihrer späteren Kollegen, Heinz Holliger, ein Werk zur Uraufführung brachte. Alle Beteiligten waren enorm aufgeregt, denn alle wollten, dass er zufrieden ist …
Ich weiß nicht, ob es für jemanden aus dem 18. Jahrhundert vorstellbar ist, wie wir heute Musik machen. Darf ich es Ihnen beschreiben? Wir spielen ein unvergleichlich größeres Repertoire als zu Ihrer Zeit – dafür aber sehr viel weniger Uraufführungen und sehr, sehr viel weniger Musik aus der Gegenwart.
Was wir aufführen, ist Musik aus mehr als 400 Jahren; das meiste im Repertoire liegt Jahrhunderte zurück. In Ihrer Zeit war das anders. Diesen langen Blick in die Vergangenheit hatten die Musiker damals nicht – es wurde mehr oder weniger nur Zeitgenössisches, die Musik der letzten Jahrzehnte, gespielt. Das war schon rein stilistisch und technisch eine andere Situation. Denn alle Musiker spielen einen Stil, waren in diesem ganz zu Hause; es gab gewissermaßen eine gemeinsame musikalische Muttersprache.
Ich wende mich auch an Sie, weil ich demnächst an der Wiener Staatsoper Ihre Entführung aus dem Serail leiten werde. Entstanden ist das Werk ja im Zuge der Idee eines Nationalsingspiels, die Kaiser Joseph II. geboren hat. Ich habe viel darüber nachgedacht, inwiefern sich der Gedanke der Aufklärung – das Erzieherische, das dem Kaiser wichtig war – in der Entführung zeigt.
Einerseits kann man natürlich sagen, dass sein gesamtes Singspiel-Projekt kein großer Erfolg war. Es hatte nicht lange Bestand; fast alle Werke, die entstanden sind, sind in meiner Zeit nicht mehr bekannt. Und doch: Man sieht in dem Projekt das große Interesse des Herrschers an der Kultur, an der Musik, an der Aufklärung. Die man übrigens auch in der Entwicklung der Figur des Bassa Selim erkennt – vom westlichen Stereotyp eines grausamen osmanischen Herrschers hin zu einem Charakter, der am Ende positive Werte wie Vergebung verkörpert.
Aber wem erzähle ich das! Sie haben das Werk ja komponiert. Liege ich richtig? Waren das die Anliegen der damaligen Zeit? Sie haben ja ins Libretto eingegriffen, was mir beweist, über welch theatralen und dramatischen Instinkt Sie verfügen.
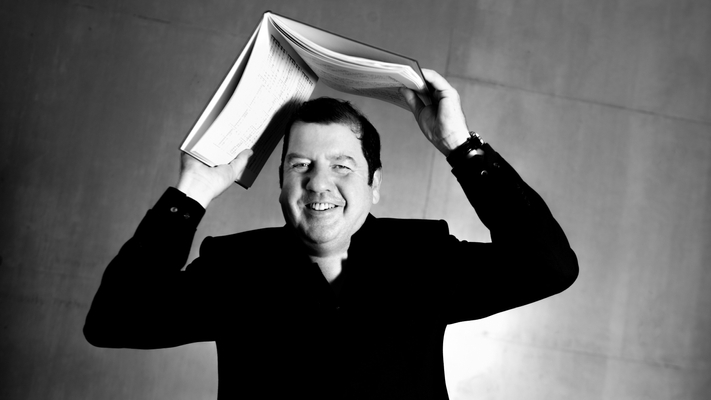
Aber dachten Sie daran, dass das, was Sie schreiben, unsterblich wird? Nur ein Beispiel unter vielen: Das Quartett Belmonte, Konstanze, Pedrillo, Blonde am Ende des 2. Aktes zieht mich jedes Mal aufs Neue in den Bann. Diese weit ausgreifenden motivischen und harmonischen Entwicklungen! Diese Entfaltung einer Vielzahl von musikalischen Charakteren. Dieses Quartett zählt meines Erachtens zu den fortschrittlichsten Stücken, die bis zu diesem Zeitpunkt – also 1782 – im Opernkontext komponiert wurden. Vergleichbar wären vielleicht nur ähnliche Passagen aus La finta giardiniera und aus Idomeneo.
Und in diesem Finale, bei der Andantino-Stelle »Wenn unsrer Ehre wegen«, fasziniert mich immer wieder, wie die einzelnen Figuren gleichzeitig unterschiedliche Emotionen auszudrücken verstehen. Was empfanden Sie, als Sie das schrieben? Sie haben diese komplexen Finali später auf die Spitze getrieben, in Ihrem berühmten Septett in Le nozze di Figaro. Wenn wir heute das Quartett spielen, bleibt die Zeit stets einen Moment lang stehen. Diese einzigartige Kombination aus musikalischer Schönheit und dem Gefühlsausdruck der einzelnen Individuen, die über die Situation nachsinnen – stand die Zeit auch still, als Sie das komponierten?
Oder Konstanze: Wie viele andere hätten sie als eindeutige Figur gezeichnet, die nur ihren Belmonte liebt. Sie aber schuften einen mehrdimensionalen Charakter, der nicht nur schwarz oder weiß ist, sondern durchaus schwankt. Das macht die Geschichte viel spannender. Und dieses Fluktuieren hört man in ihrer Musik; man spürt, dass sie auch Bassa Selim nicht gänzlich abgeneigt ist.
Ich möchte noch einmal an die historische Aufführungssituation anschließen: Wie klang das alte Burgtheater, in dem ja nicht nur die Entführung aus dem Serail, sondern auch Le nozze di Figaro und Così fan tutte uraufgeführt wurden? War das Haus akustisch perfekt für diese Opern? Oder gab es damals auch schon Fragen der Balance – nicht nur zwischen dem Orchester und dem Sängerensemble, sondern auch innerhalb des Orchesters?
Uns beschäftigt das heute ziemlich. Denn wenn ich ein Werk wie die Entführung in der Wiener Staatsoper dirigiere, dann ist es ein zweifelsohne größeres und vor allem höheres Haus als das historische Burgtheater. Wobei hier in Wien, in der Staatsoper, die Entfernung zwischen Bühne und Parkett gar nicht so groß ist – das geht noch viel herausfordernder, etwa in manchen amerikanischen Häusern.
Mich würde ja interessieren, was Sie zu diesen Theatern unserer Gegenwart sagten. Würden Sie neue, ganz andere Opern schreiben?
Eine Sache noch: Stimmt es, dass Joseph II. nach der Entführung meinte: »Gewaltig viel Noten, lieber Mozart«? Ich frage mich immer wieder, ob das nicht nur eine apokryphe Geschichte ist. Ich erkläre mir den Satz ja so, dass Joseph II. es ganz anders meinte, nämlich im umgekehrten Sinne. Im Vergleich zu den zahlreichen, qualitativ schlechteren Werken, die damals entstanden sind – Opern, die schwächer in der Orchestrierung waren, blasser in der Farbigkeit und im Ausdruck – im Gegensatz zu diesen waren es freilich gewaltig viel Noten.
Vielleicht hat Joseph II. die Sache einfach überrascht, verwundert? Er hat einfach kein so komplexes und reichhaltiges Werk erwartet? Haben Sie wirklich so keck geantwortet, wie erzählt wird: »Grad so viel Noten, Eure Majestät, wie nötig sind«? Konnte man so mit Kaisern sprechen? Oder hatten Sie einen besonderen Stand bei ihm?
Entschuldigen Sie bitte diese gewaltig vielen Fragen – aber wie vorhin gesagt: Je tiefer man in eine Sache eindringt, umso mehr will man wissen. Und wenn Sie kommen und zuhören wollen: ab 12. Oktober im Haus am Ring! Die Besetzung wird Sie begeistern, wenn ich das so anmerken darf …